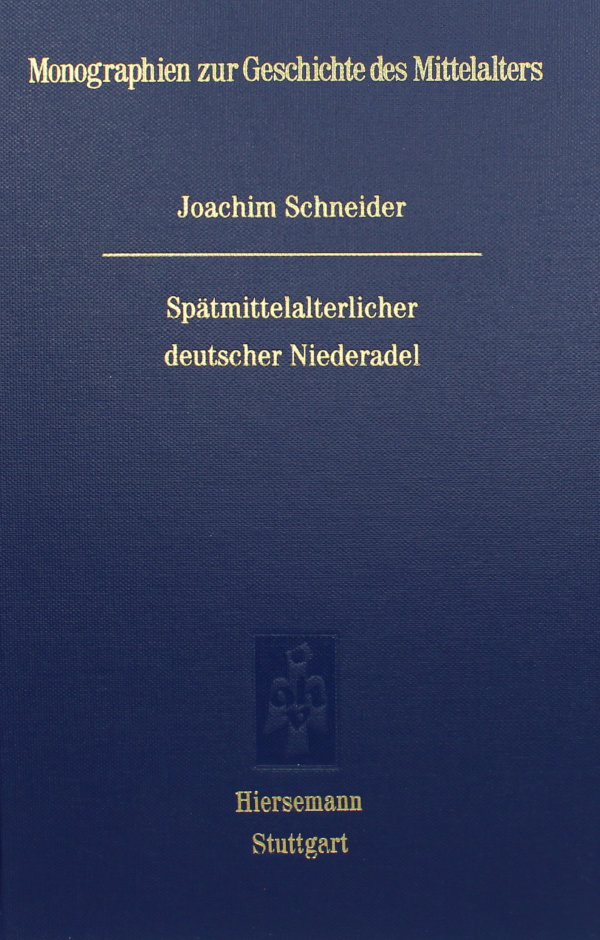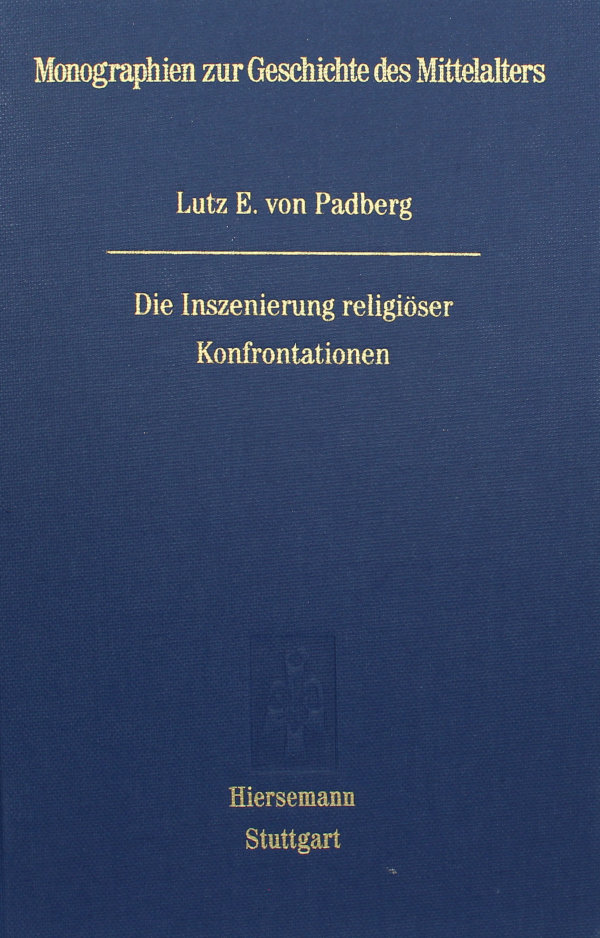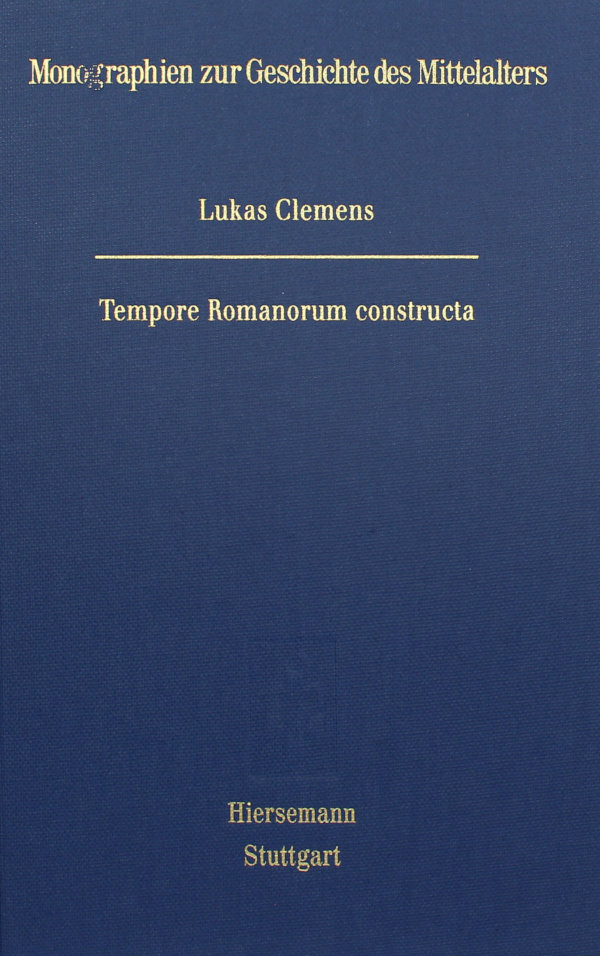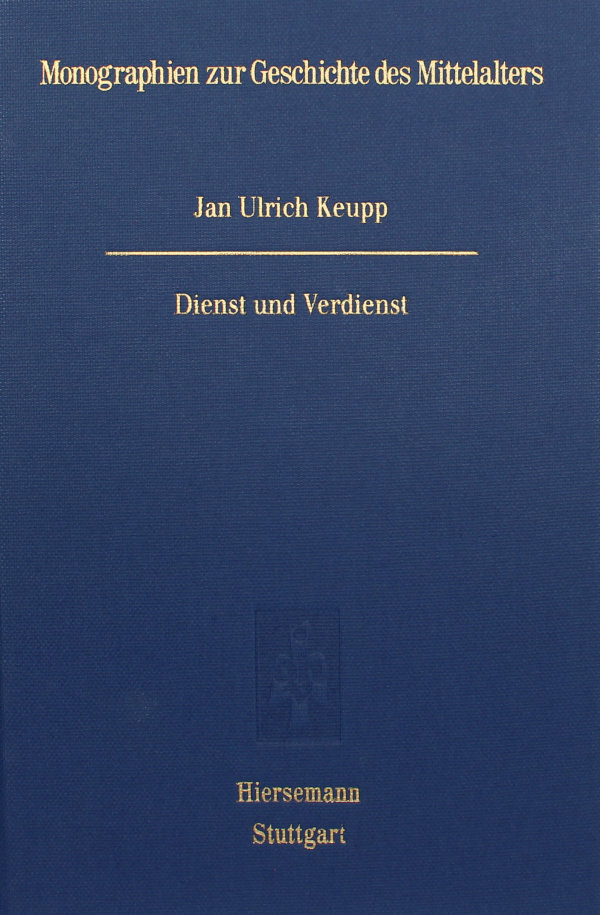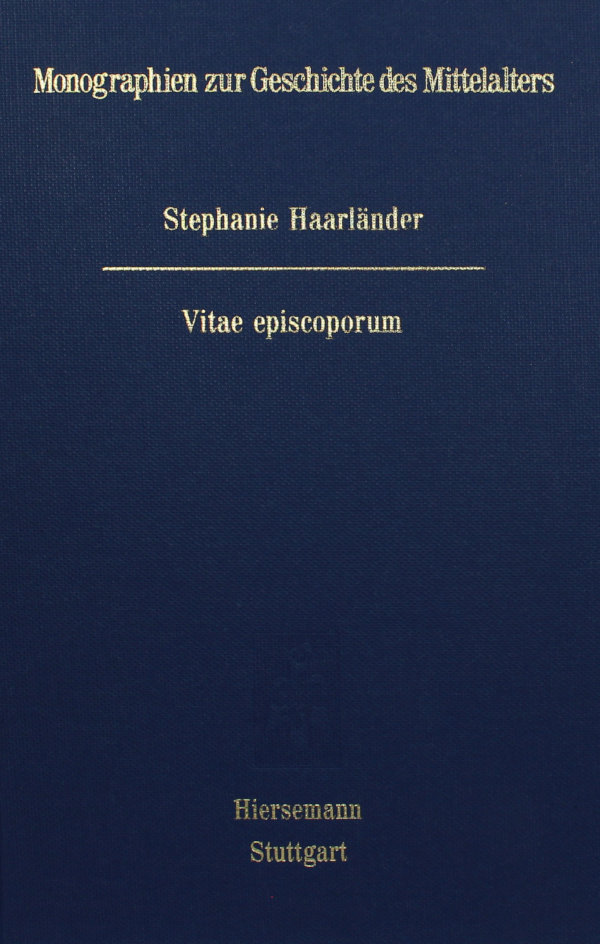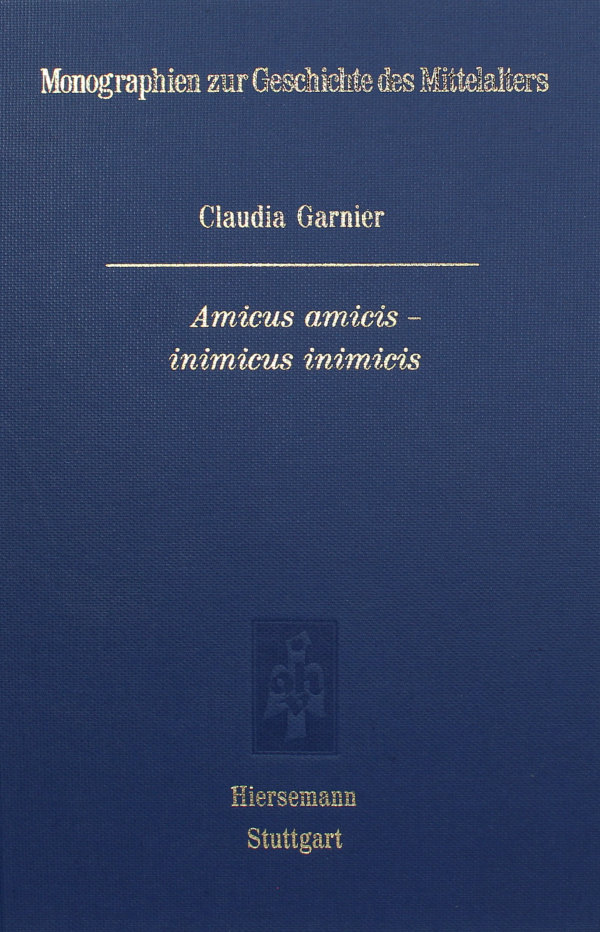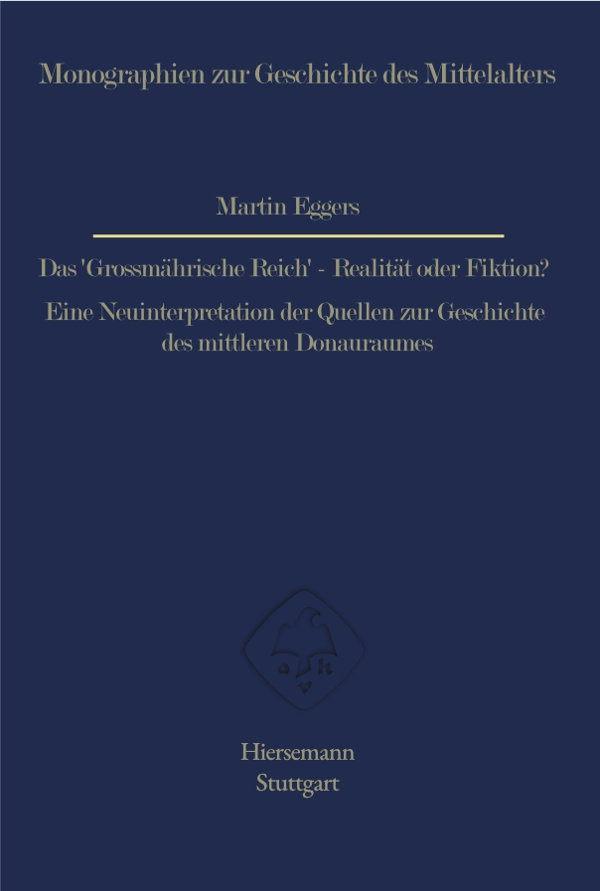Die Reihe „Monographien zur Geschichte des Mittelalters“ wurde 1970 gegründet und in der Folge von Karl Bosl, Friedrich Prinz, Alfred Haverkamp sowie seit 2017 von Steffen Patzold und Harald Müller herausgegeben. Sie versteht sich als wissenschaftliches Veröffentlichungsforum für mediävistische Forschung aller Teilepochen, aller Sektoren und methodischen Ansätze und aller Gattungen. Arbeiten zur Landes-, Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte stehen neben solchen zur Geistesgeschichte und Kulturgeschichte im weitesten Sinn. Der räumliche Horizont ist europäisch. Die Epoche von der Spätantike bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts wird als eine Ära der Vormoderne verstanden, deren Lebensformen es jeweils in der Darstellung menschlichen Handelns und Denkens zu bestimmen gilt.
Subskriptionspreis für die Bezieher der gesamten Reihe, gültig bis zum Erscheinen
Spätmittelalterlicher deutscher Niederadel Ein landschaftlicher Vergleich
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 52
ISBN: 978-3-7772-0312-6
Die Inszenierung religiöser Konfrontationen Theorie und Praxis der Missionspredigt im frühen Mittelalter
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 51
ISBN: 978-3-7772-0324-9
Tempore Romanorum constructa Zur Nutzung und Wahrnehmung antiker Ãberreste nördlich der Alpen während des Mittelalters
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 50
ISBN: 978-3-7772-0301-0
Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung und Familienorganisation im fürstlichen Hochadel Das Beispiel der Wettiner von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 49
ISBN: 978-3-7772-0228-0
Friedrich Prinz (Hrsg.) Dienst und Verdienst Die Ministerialen Friedrich Barbarossas und Heinrichs VI.
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 48
ISBN: 978-3-7772-0229-7
Friedrich Prinz (Hrsg.) Vitae episcoporum Eine Quellengattung zwischen Hagiographie und Historiographie, untersucht an Lebensbeschreibungen von Bischöfen des Regnum Teutonicum im Zeitalter der Ottonen und Salier
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 47
ISBN: 978-3-7772-0022-4
Friedrich Prinz (Hrsg.) Amicus amicis Inimicus inimicis Politische Freundschaft und Fürstliche Netzwerke im 13. Jahrhundert
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 46
ISBN: 978-3-7772-0001-9
Friedrich Prinz (Hrsg.) Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 45
ISBN: 978-3-7772-9919-8
Friedrich Prinz (Hrsg.) Amicitia Zur Geschichte personaler, sozialer, politischer und geistlicher Beziehungen im frühen Mittelalter
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 44
ISBN: 978-3-7772-9917-4
Stadtplanung, Bauprojekte und Grossbaustellen im 10. und 11. Jahrhundert Vergleichende Studien zu den Kathedralstädten westlich des Rheins
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 43
ISBN: 978-3-7772-9820-7
Königsherrschaft im Streit Konfliktaustragung in der Regierungszeit Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespräch und Schriftlichkeit
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 42
ISBN: 978-3-7772-9721-7
Conversio und christianitas Frauen in der Christianisierung vom 5. bis 8. Jahrhundert
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 41
ISBN: 978-3-7772-9511-4
Das 'Grossmährische Reich' - Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 40
ISBN: 978-3-7772-9502-2
Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und Mönchtum in Italien von den Anfängen bis zur Zeit Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 39
ISBN: 978-3-7772-9407-0
Vom Klosterhaushalt zum Staatshaushalt Der zisterziensische Beitrag
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 38
ISBN: 978-3-7772-9406-3
Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur des Klosters Fulda in der Karolingerzeit Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 36
ISBN: 978-3-7772-9126-0
Ducatus Baiuvariorum Das bairische Herzogtum der Agilolfinger
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 35
ISBN: 978-3-7772-9108-6
Studium Generale Erfordense Zum Erfurter Schulleben im 13. und 14. Jahrhundert
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 34
ISBN: 978-3-7772-8917-5
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 33
ISBN: 978-3-7772-8809-3
Agilolfingerstudien Untersuchungen zur Geschichte einer adligen Familie im 6. und 7. Jahrhundert
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 32
ISBN: 978-3-7772-8613-6
Aristocracy in Provence The Rhône Basin at the Dawn of the Carolingian Age
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 31
ISBN: 978-3-7772-8513-9
Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 30
ISBN: 978-3-7772-8432-3
Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou (1265-1285) Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 29
ISBN: 978-3-7772-8418-7
Gral. Die hochmittelalterliche Glaubenskrise im Spiegel der Literatur Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 28
ISBN: 978-3-7772-8316-6