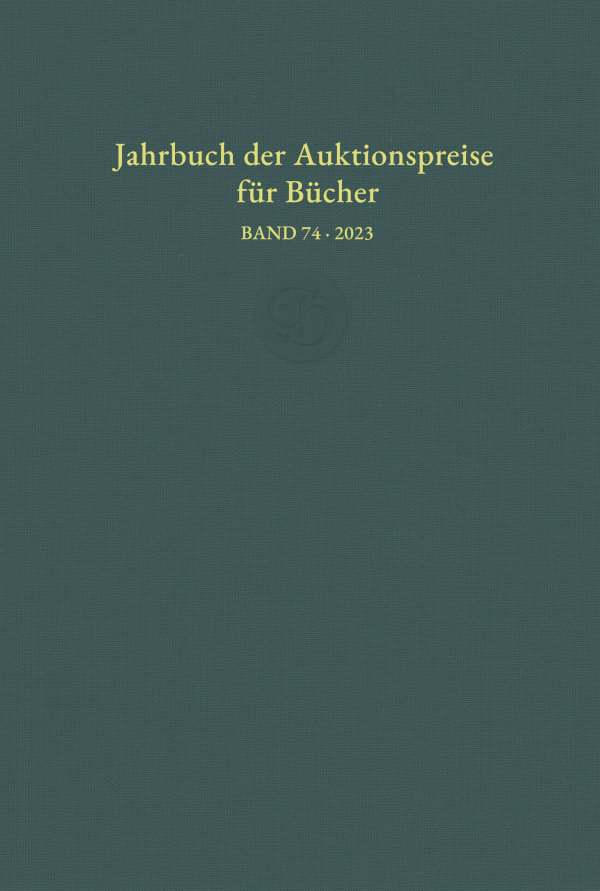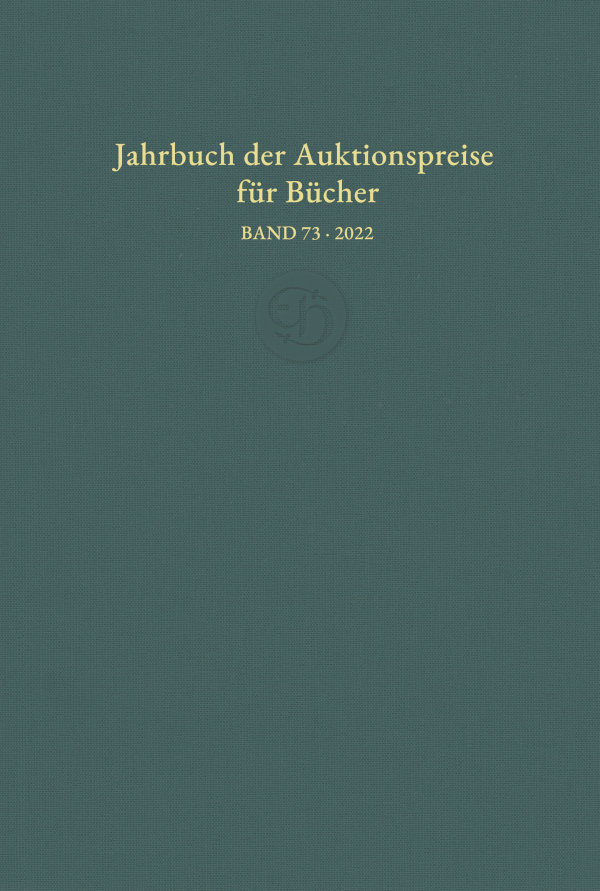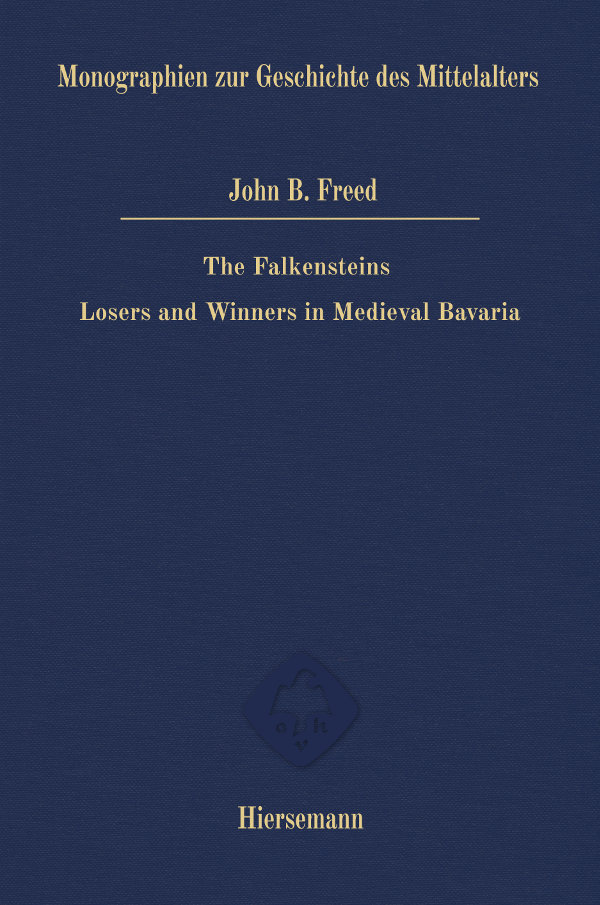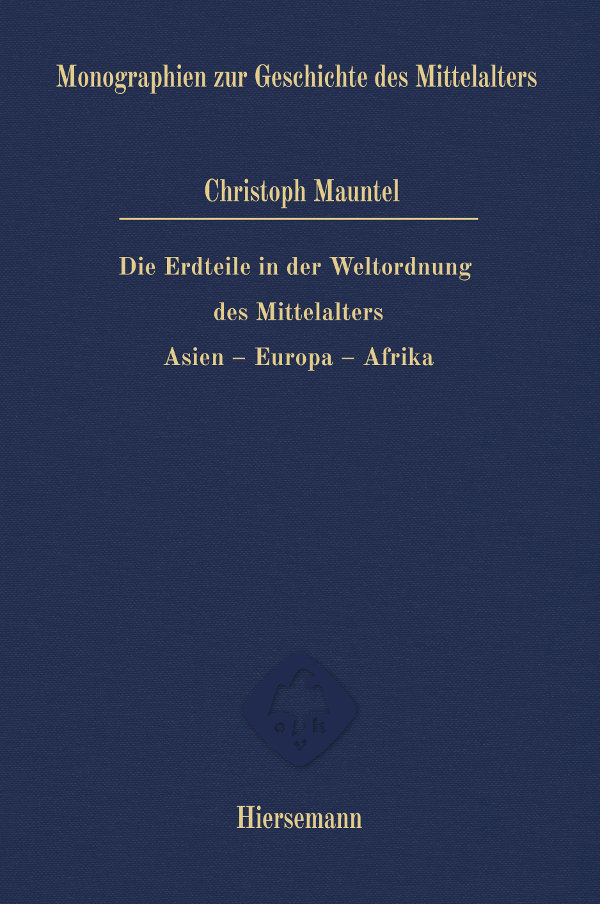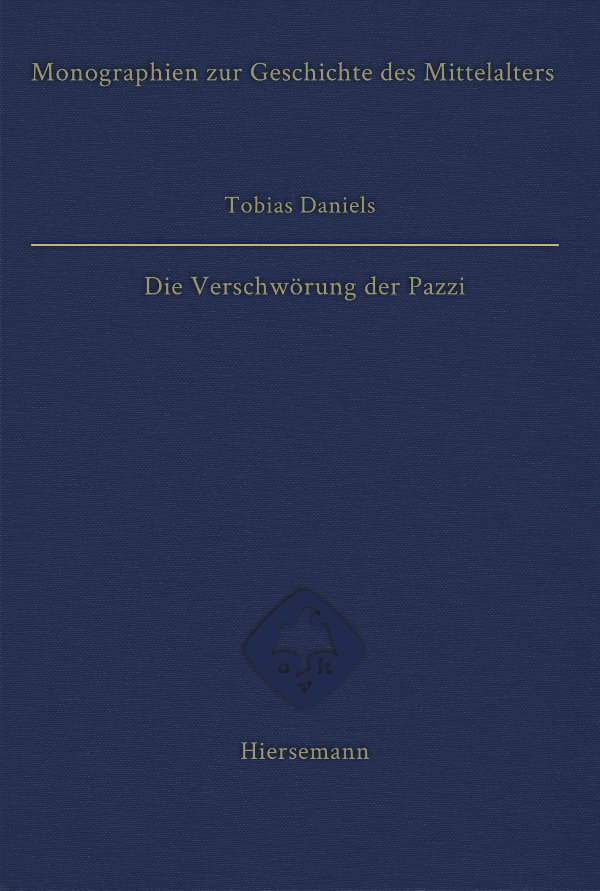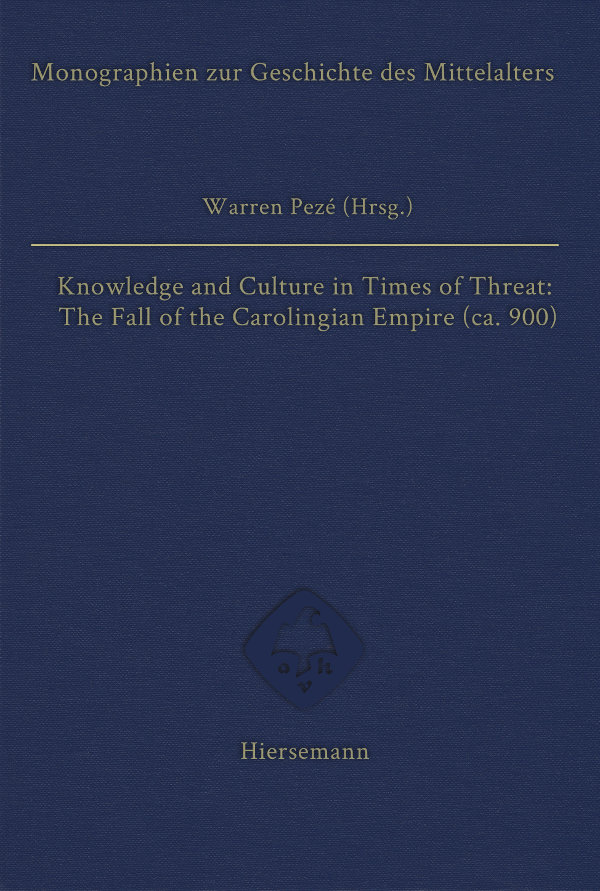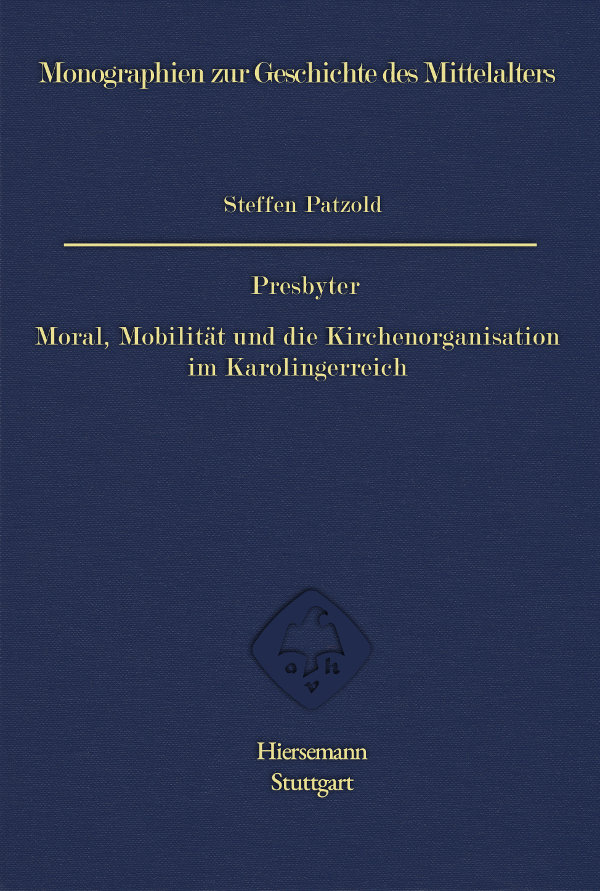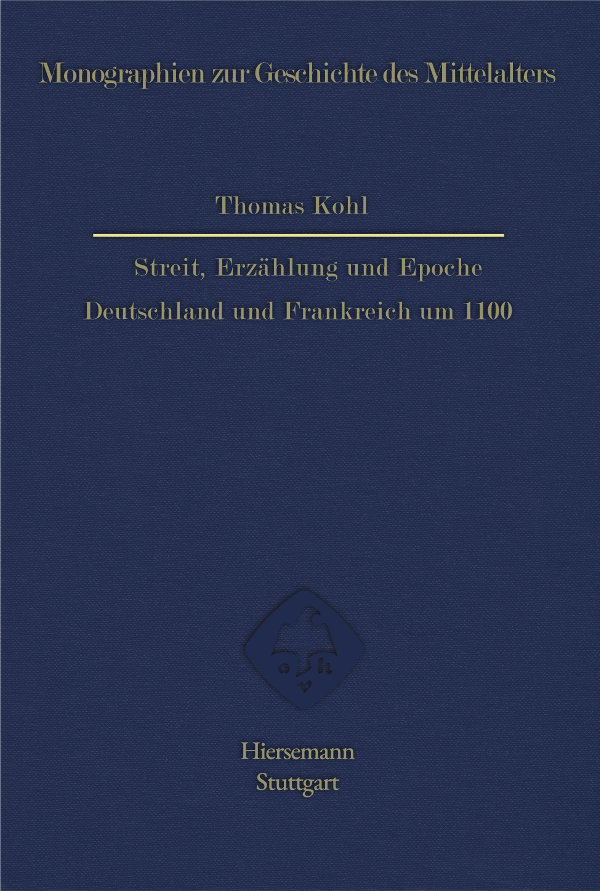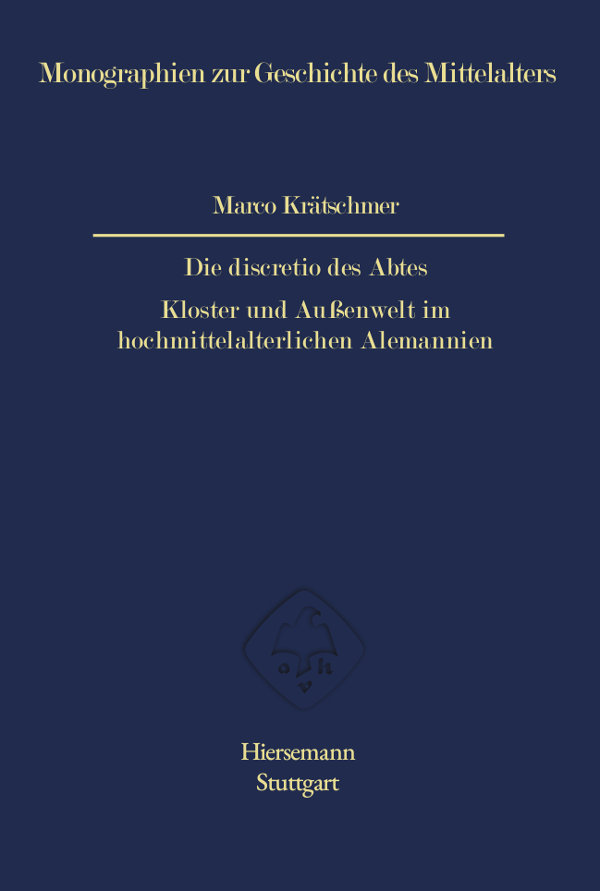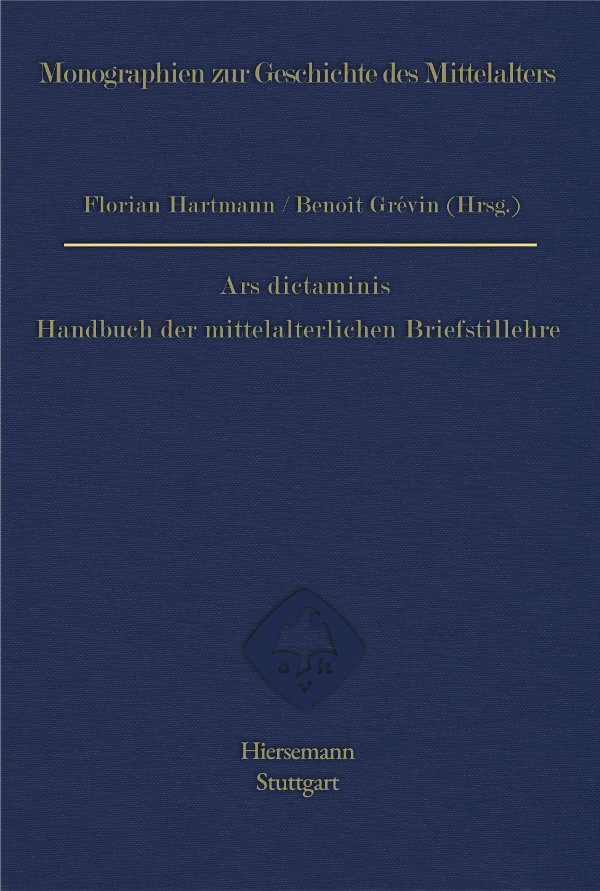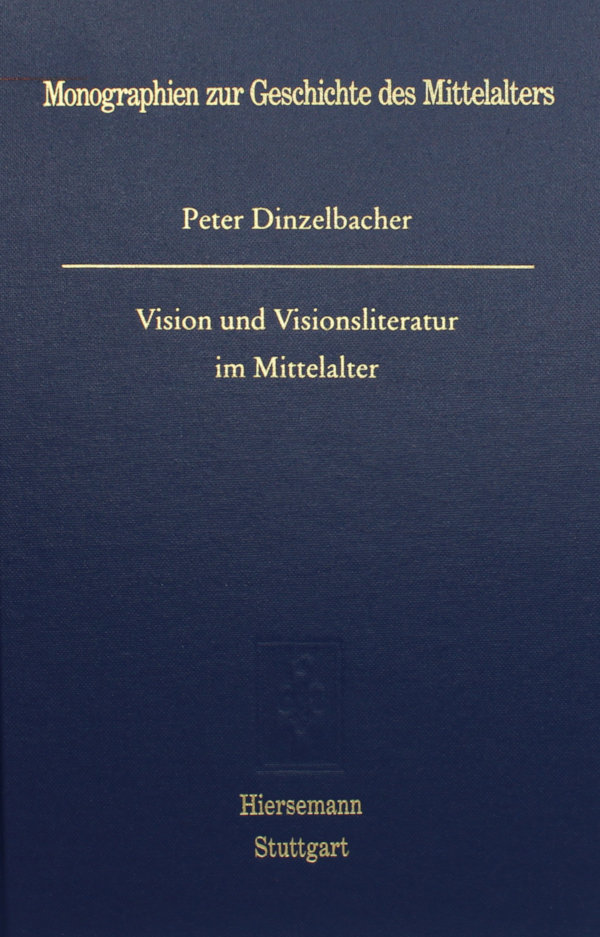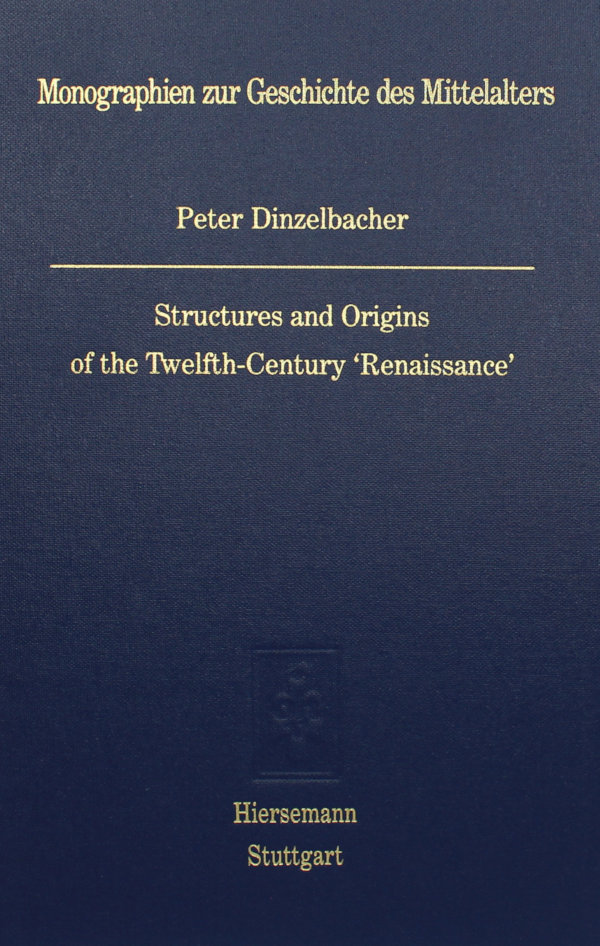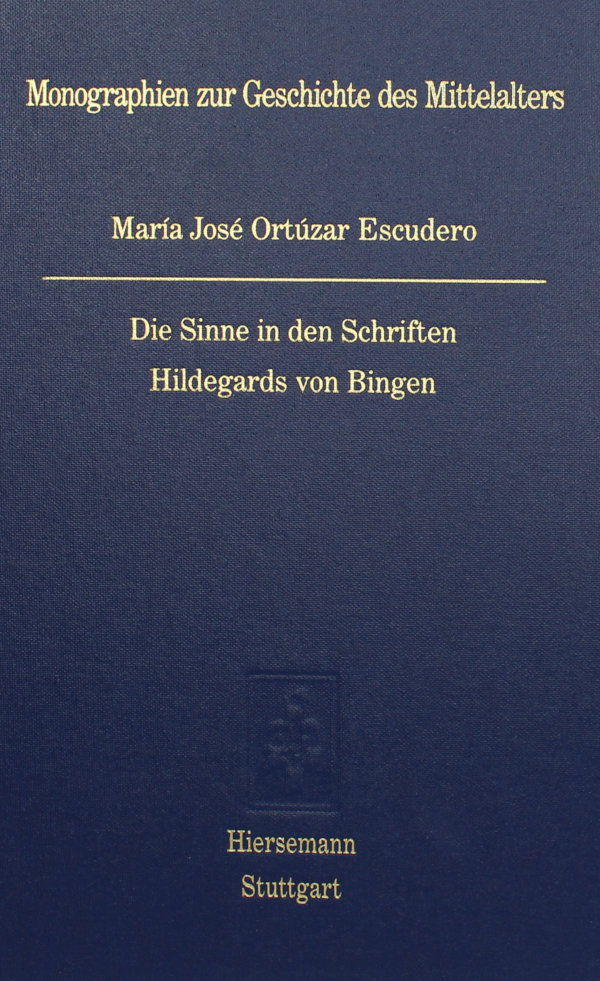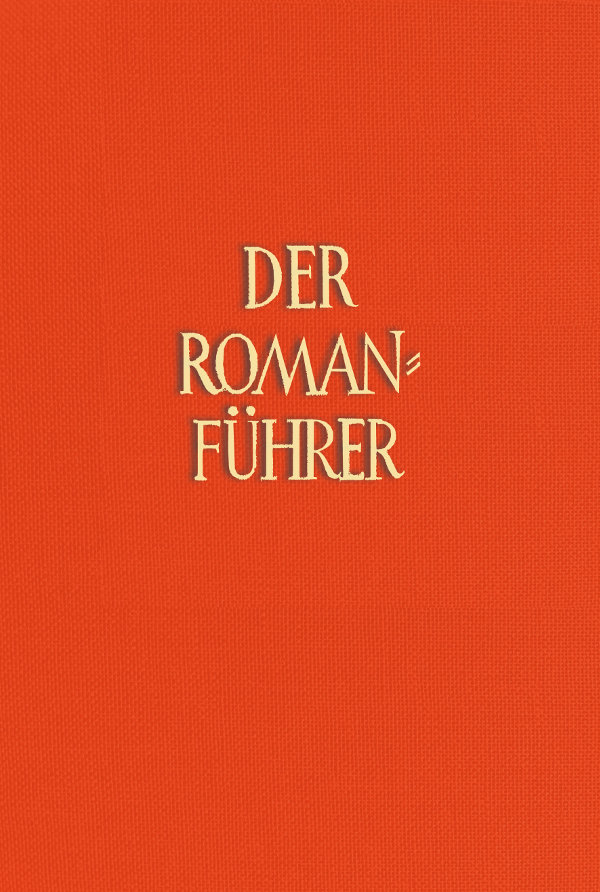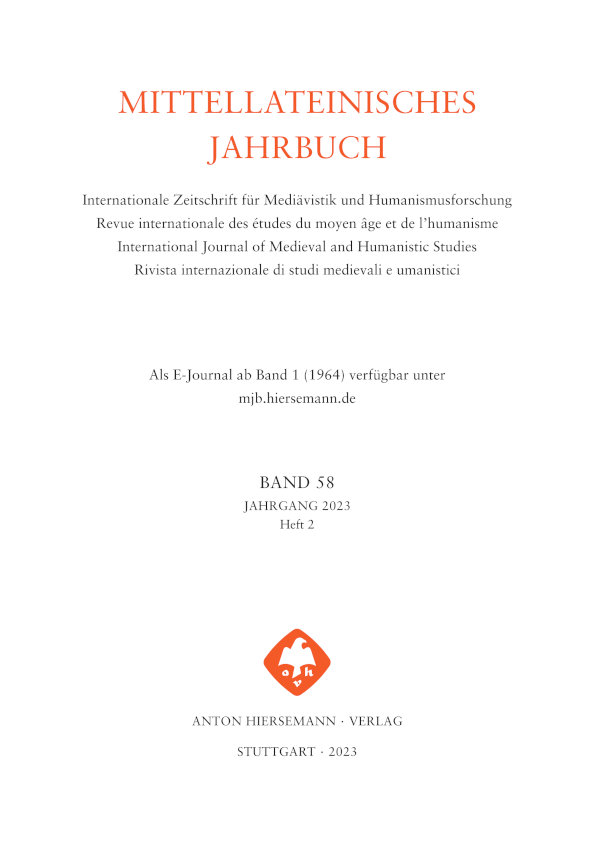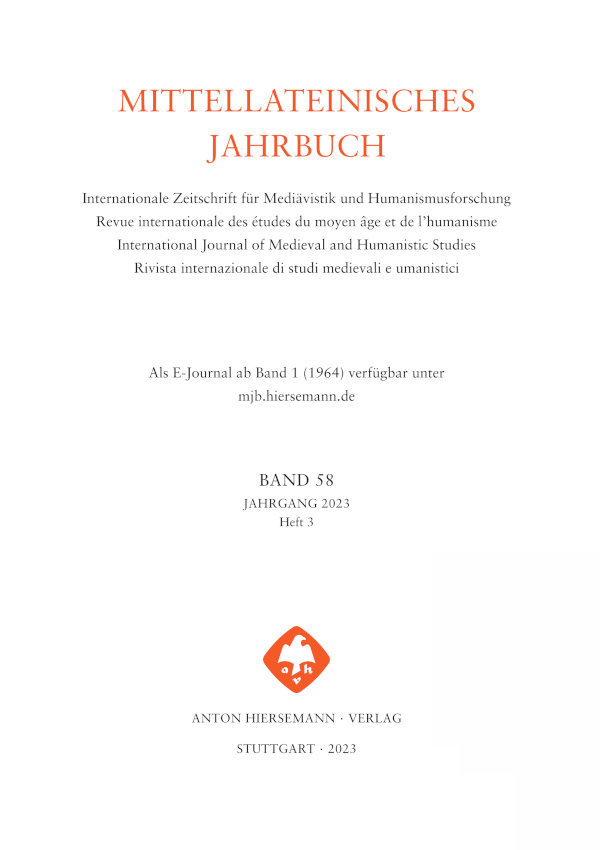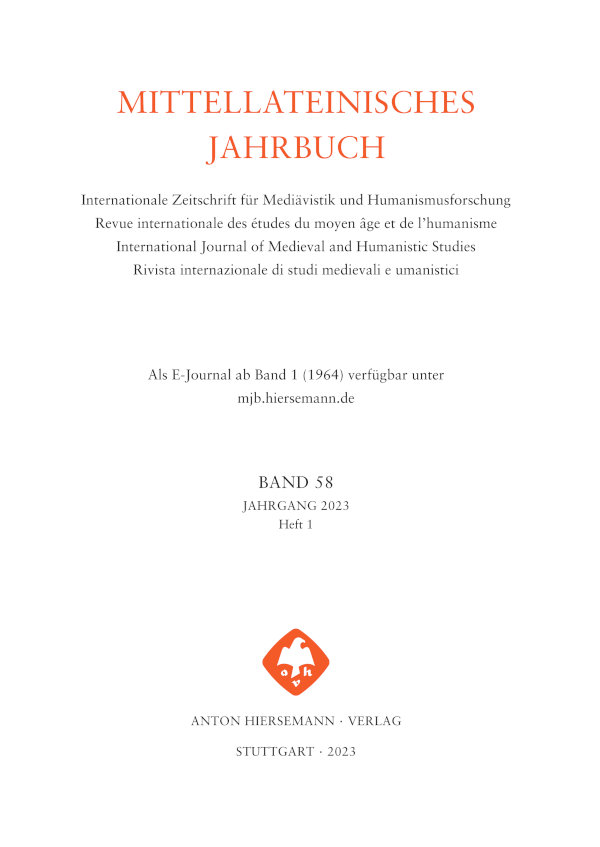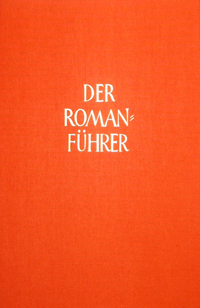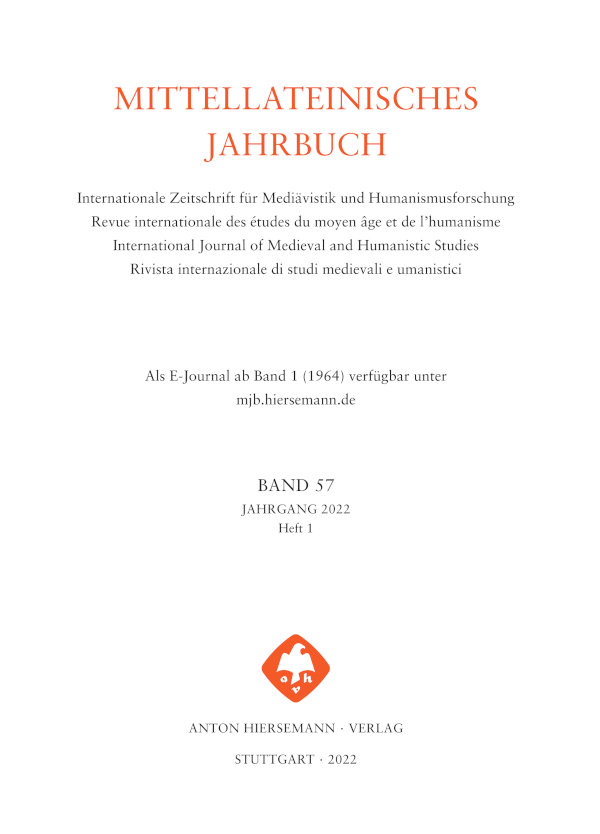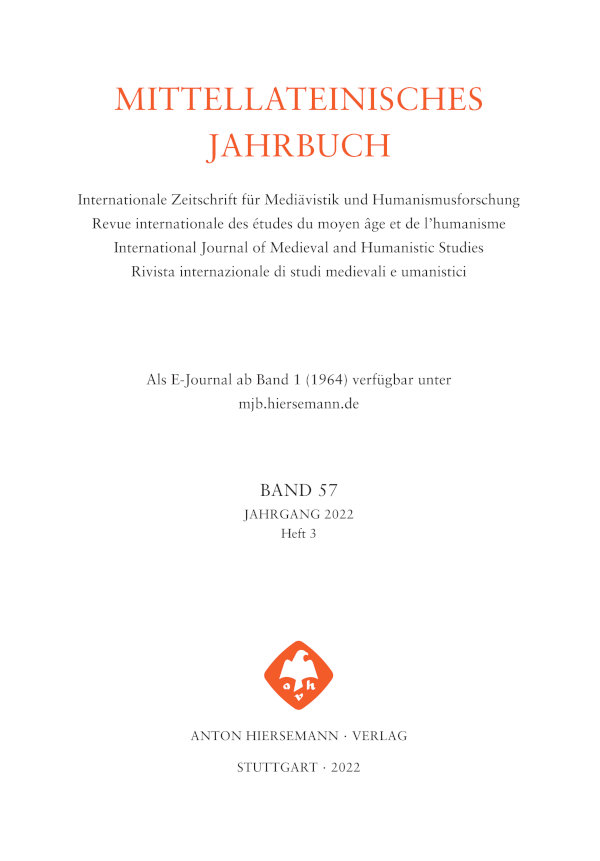Band-Nr.: 74
ISBN: 978-3-7762-2401-6
Band-Nr.: 74
ISBN: 978-3-7762-2400-9
Band-Nr.: 73
ISBN: 978-3-7762-2302-6
Band-Nr.: 73
ISBN: 978-3-7762-2300-2
The Falkensteins: Losers and Winners in Medieval Bavaria Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 72
ISBN: 978-3-7772-2305-6
Die Erdteile in der Weltordnung des Mittelalters Asien – Europa – Afrika
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 71
ISBN: 978-3-7772-2311-7
Die Verschwörung der Pazzi Ein politischer Skandal und seine europäischen Resonanzen
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 70
ISBN: 978-3-7772-2037-6
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 69
ISBN: 978-3-7772-2024-6
Presbyter Moral, Mobilität und die Kirchenorganisation im Karolingerreich
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 68
ISBN: 978-3-7772-2023-9
Streit, Erzählung und Epoche Deutschland und Frankreich um 1100
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 67
ISBN: 978-3-7772-1926-4
Die discretio des Abtes Kloster und Außenwelt im hochmittelalterlichen Alemannien
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 66
ISBN: 978-3-7772-1907-3
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 65
ISBN: 978-3-7772-1906-6
Vision und Visionsliteratur im Mittelalter Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 64
ISBN: 978-3-7772-1719-2
Structures and Origins of the Twelfth-Century 'Renaissance' Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 63
ISBN: 978-3-7772-1704-8
Die Sinne in den Schriften Hildegards von Bingen Ein Beitrag zur Geschichte der Sinneswahrnehmung
Reihe: Monographien zur Geschichte des Mittelalters
Band-Nr.: 62
ISBN: 978-3-7772-1619-5
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 59
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978‑3‑7772‑2410-7
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 59
Heft-Nr.: 2
ISBN: 978‑3‑7772‑2411-4
Reihe: Der Romanführer
Band-Nr.: 58
ISBN: 978-3-7772-2135-9
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 58
Heft-Nr.: 2
ISBN: 978‑3‑7772‑2318-6
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 58
Heft-Nr.: 3
ISBN: 978‑3‑7772‑2319-3
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 58
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978‑3‑7772‑2317-9
Reihe: Der Romanführer
Band-Nr.: 57
ISBN: 978-3-7772-2021-5
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978‑3‑7772‑2209-7
Reihe: Mittellateinisches Jahrbuch
Band-Nr.: 57
Heft-Nr.: 3
ISBN: 978‑3‑7772‑2211-0