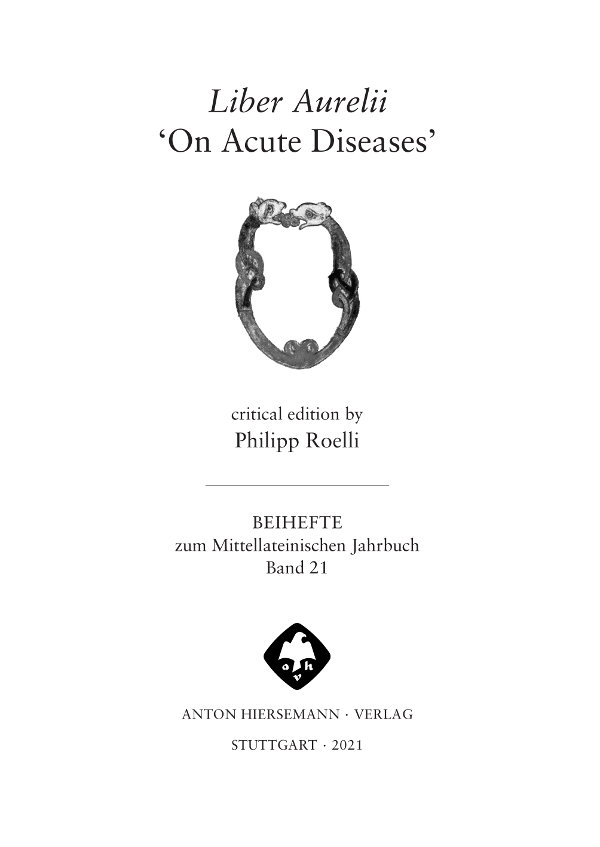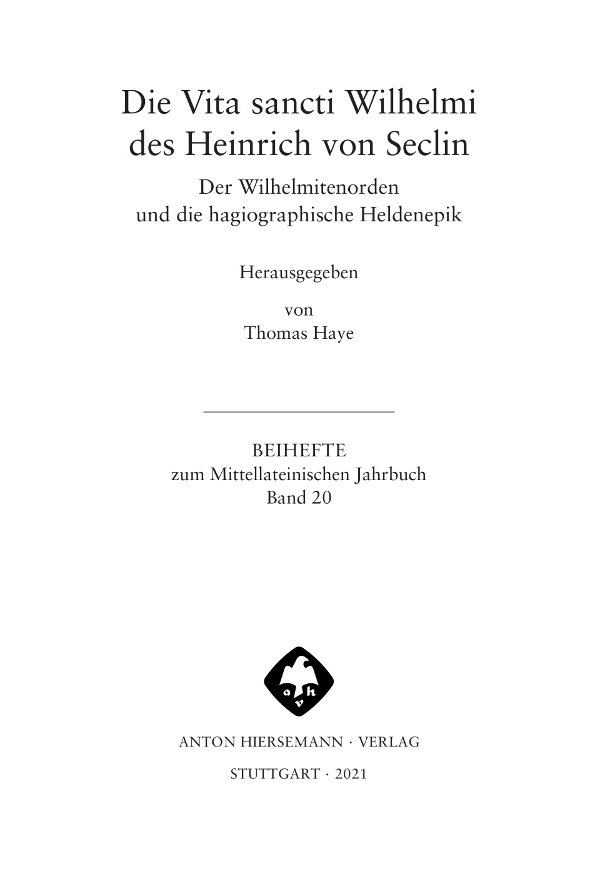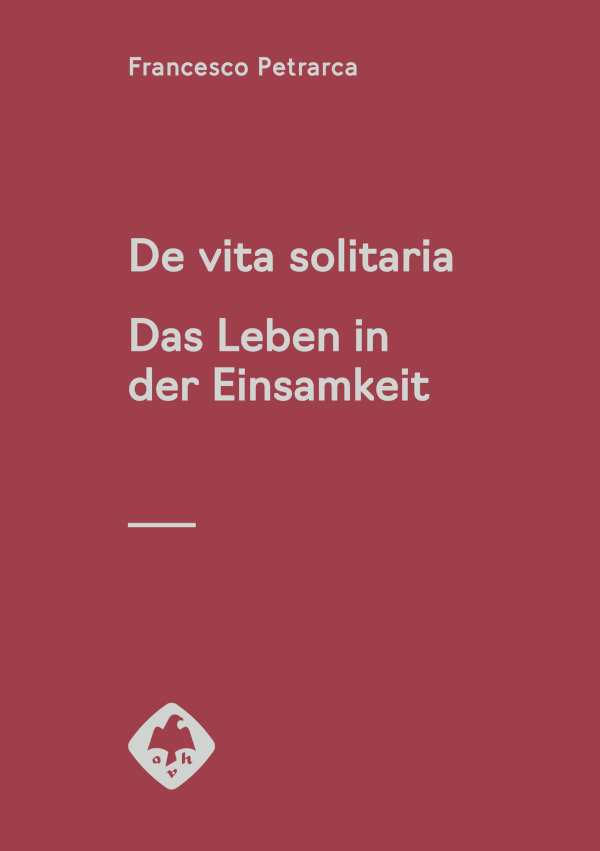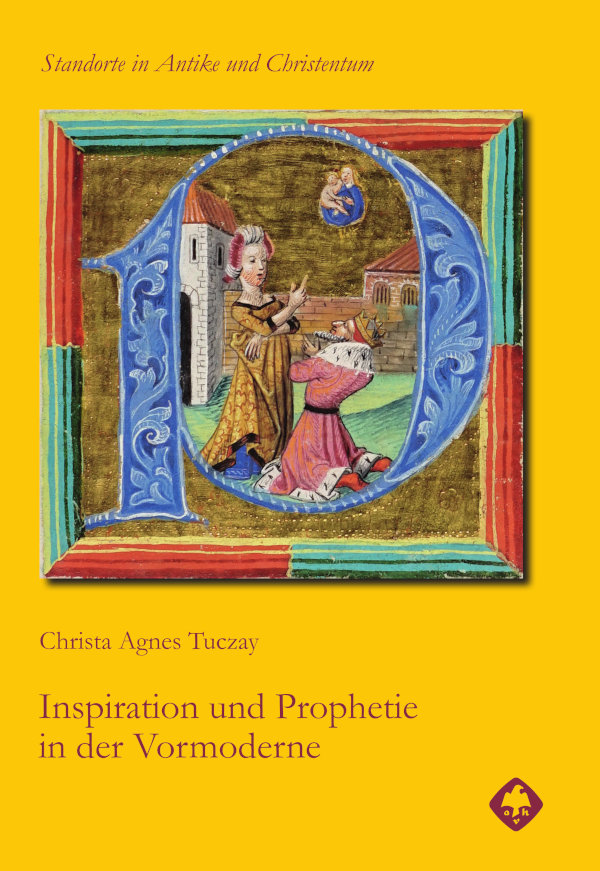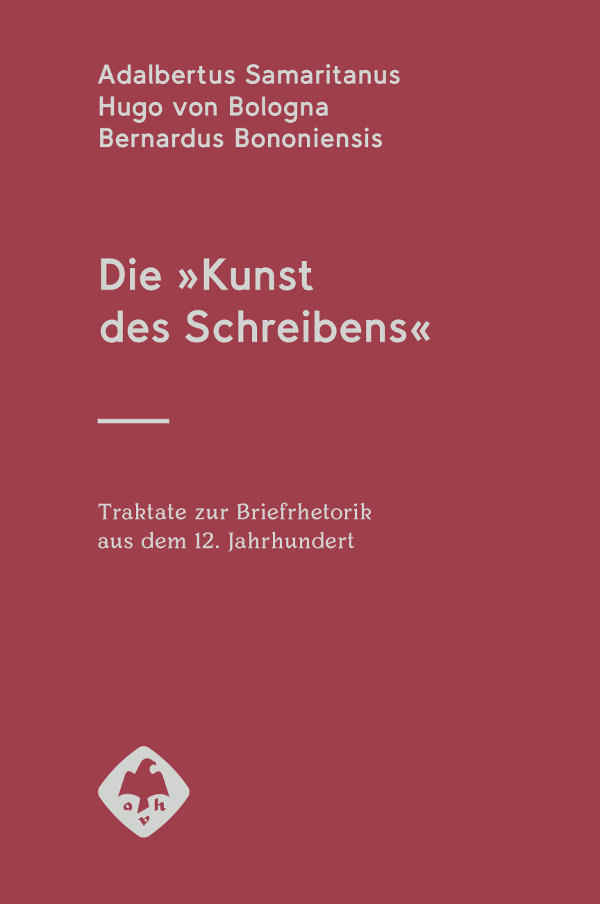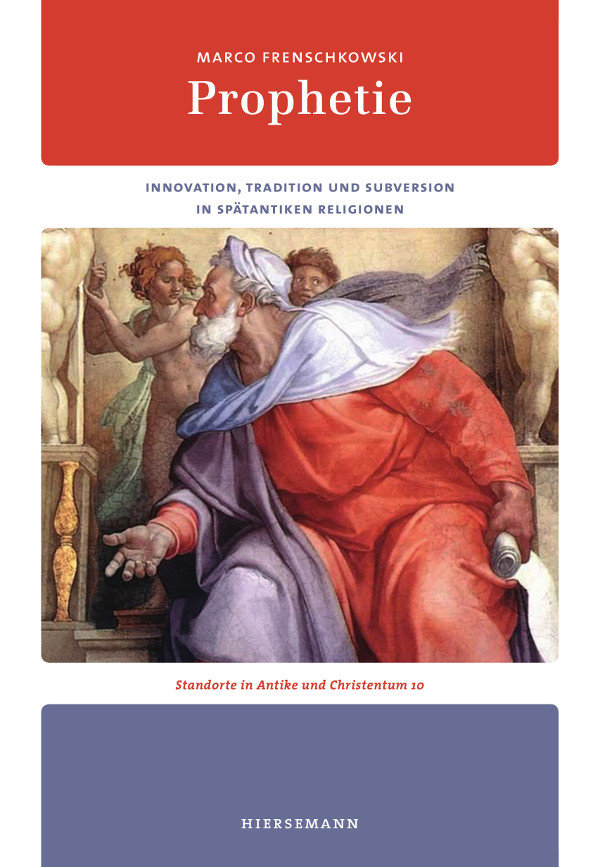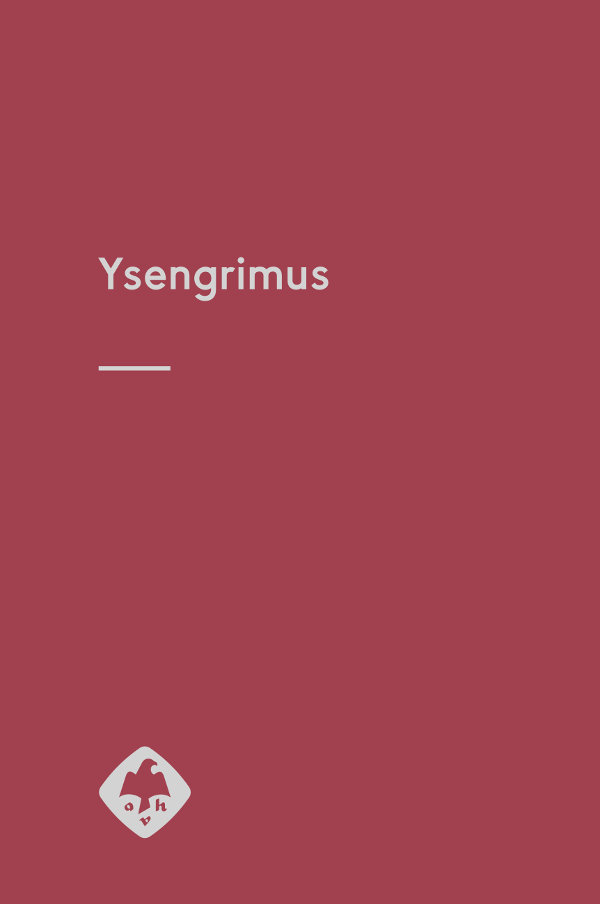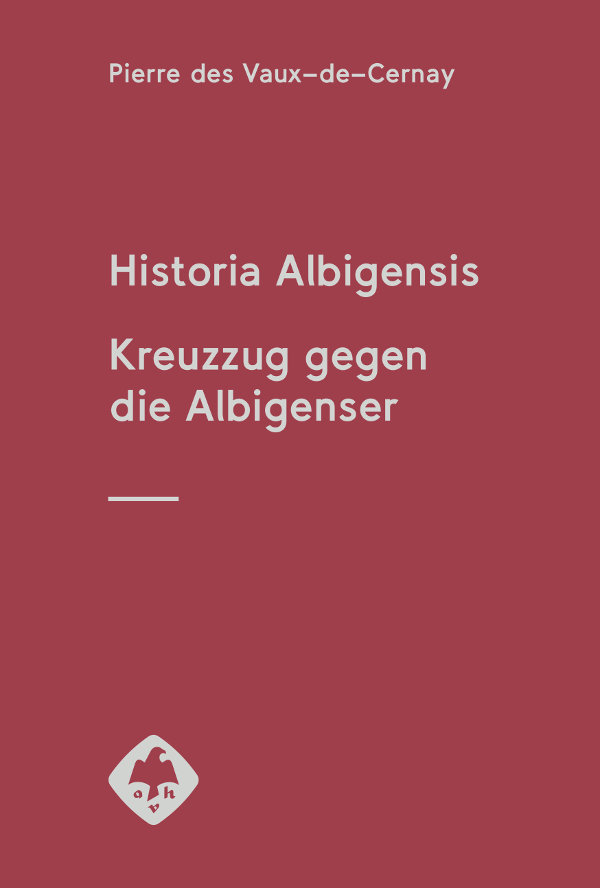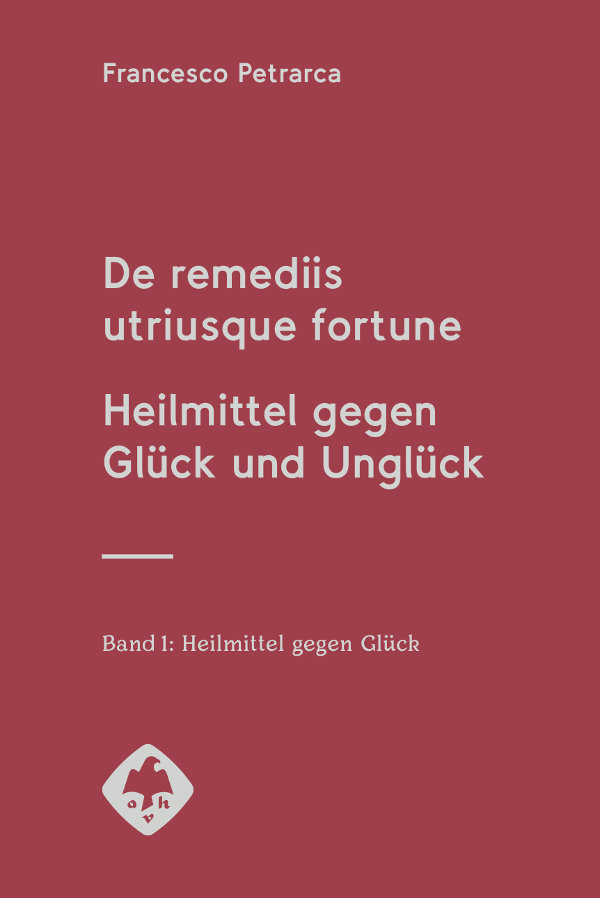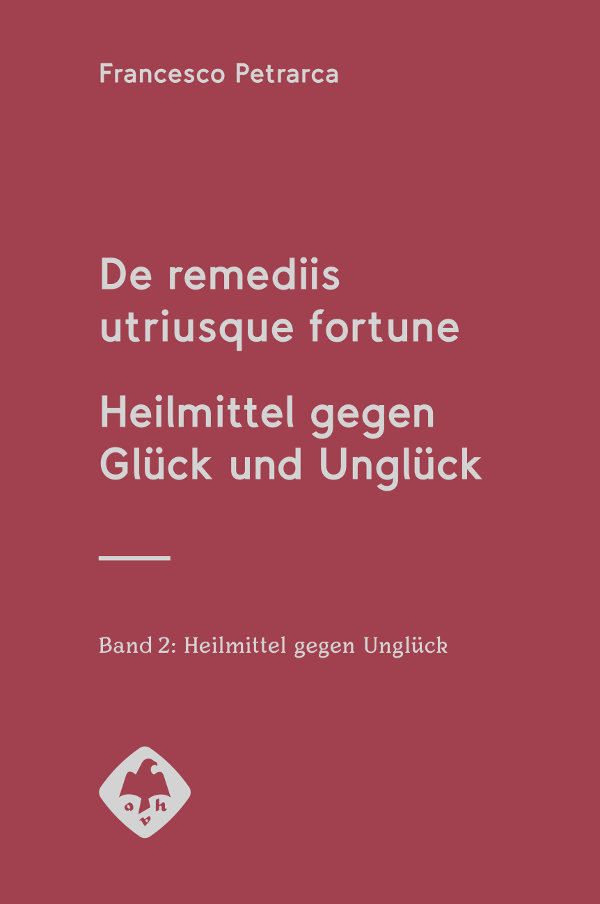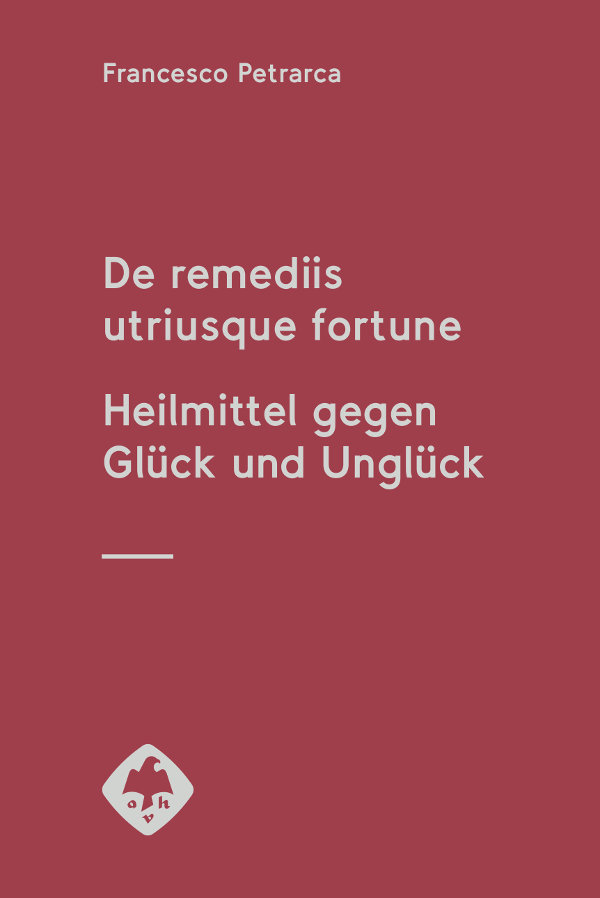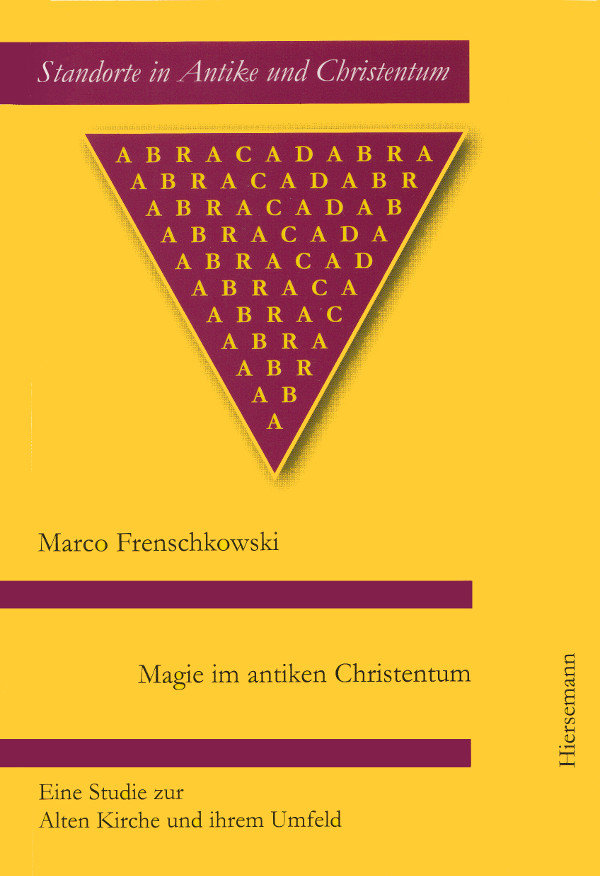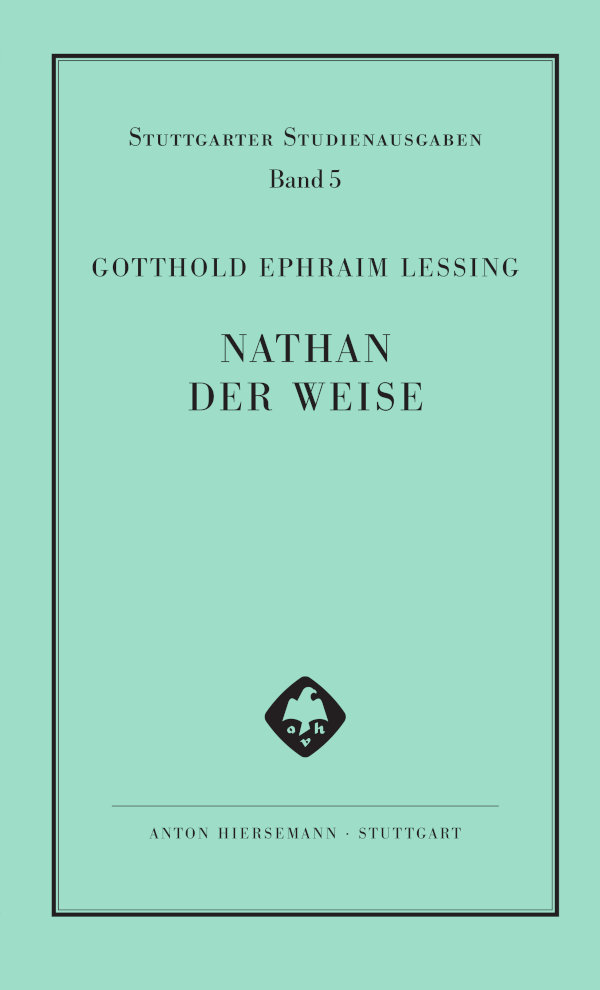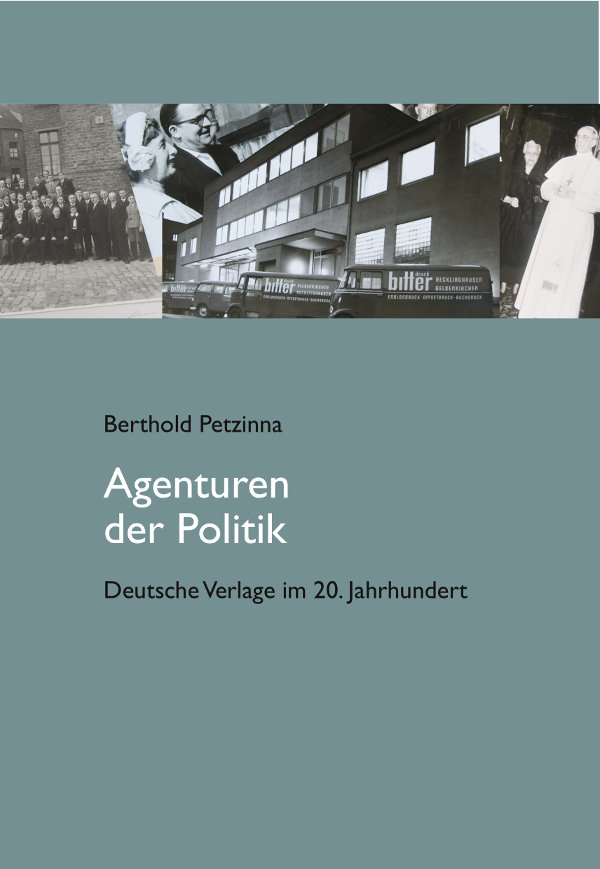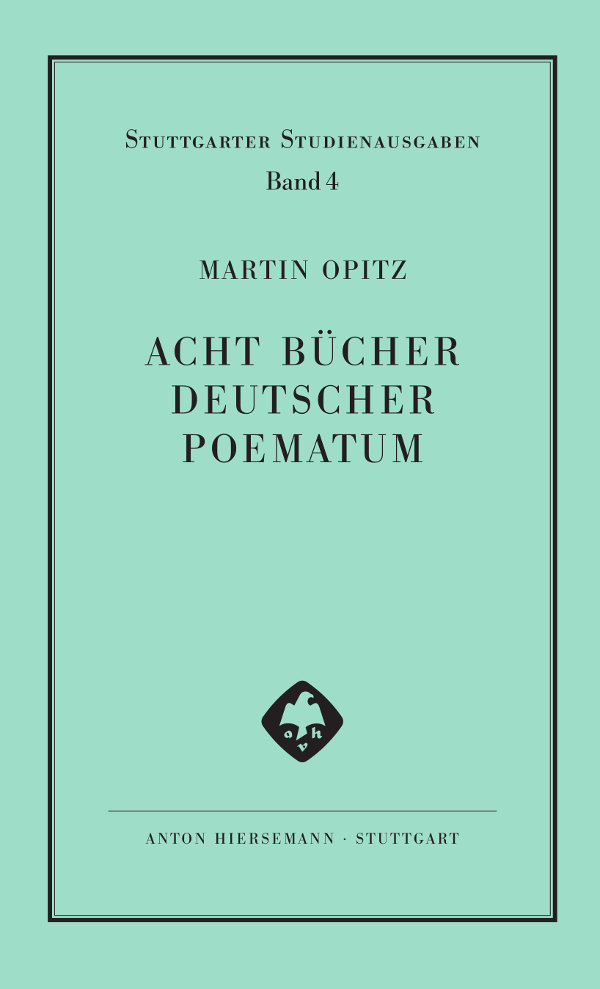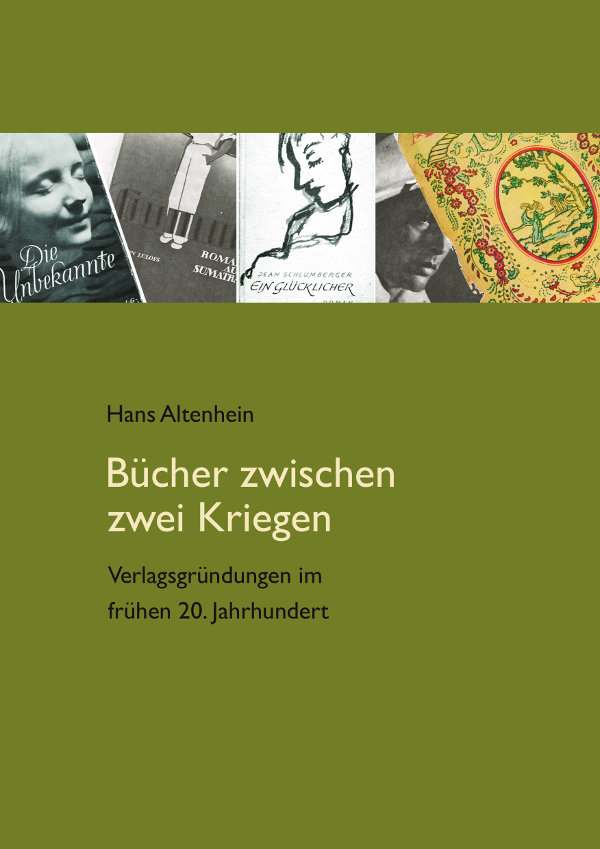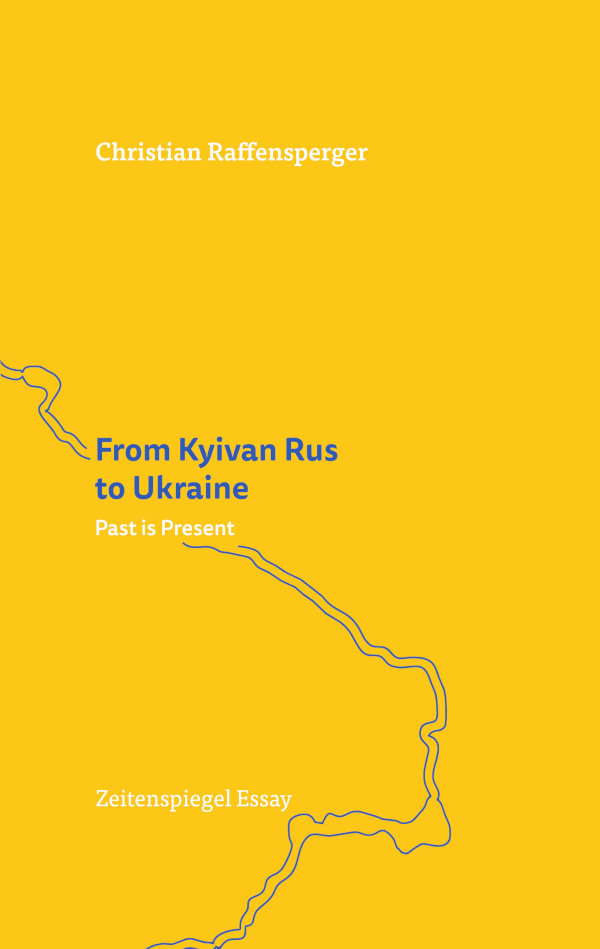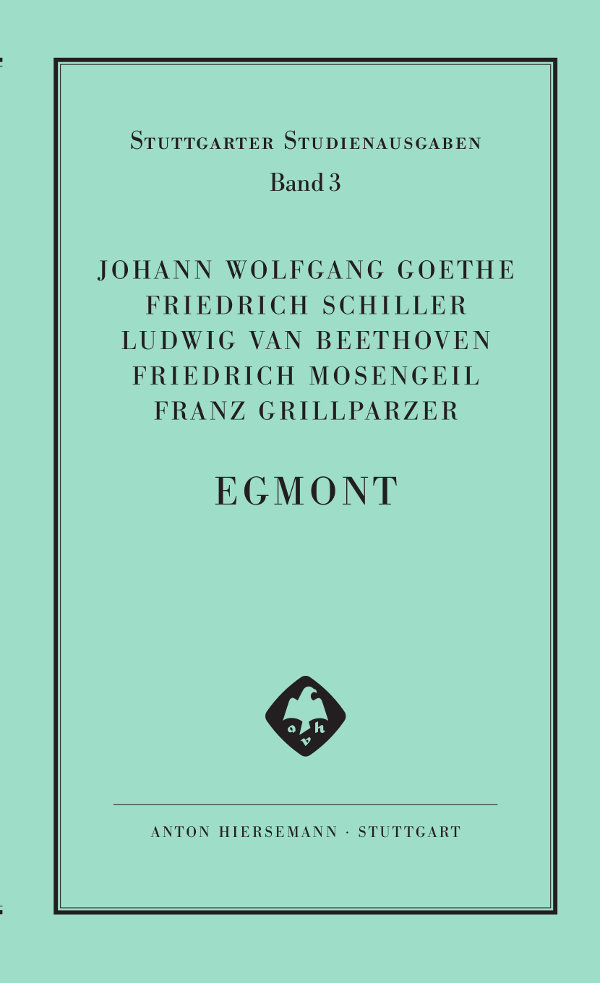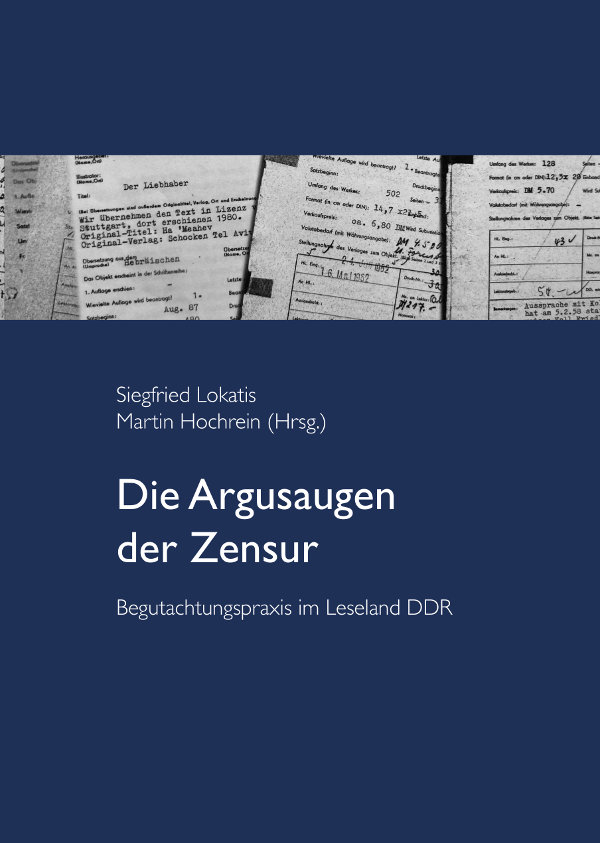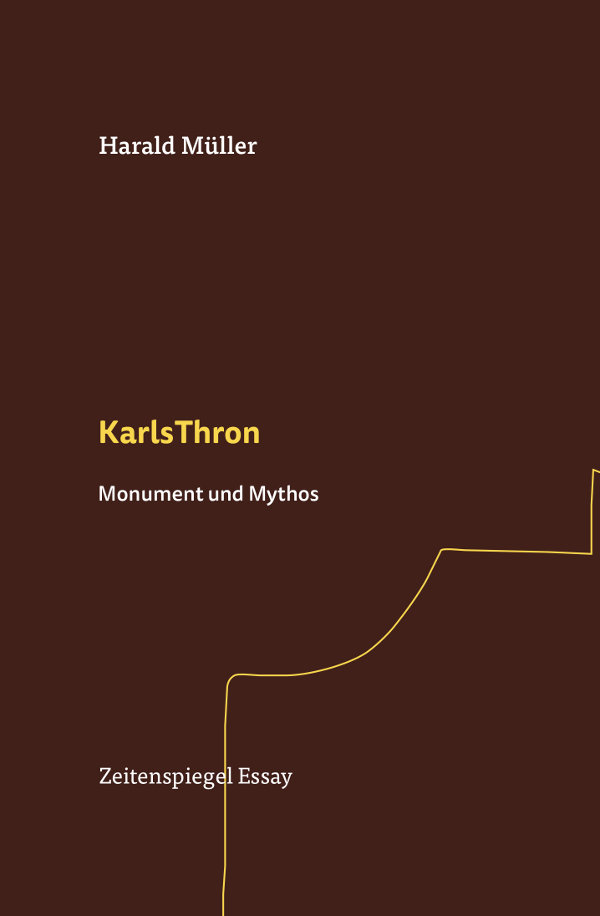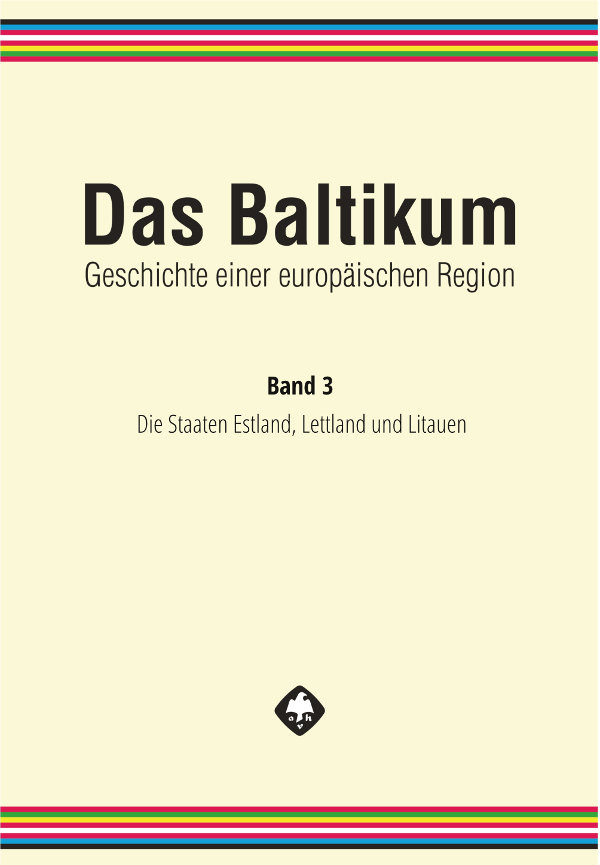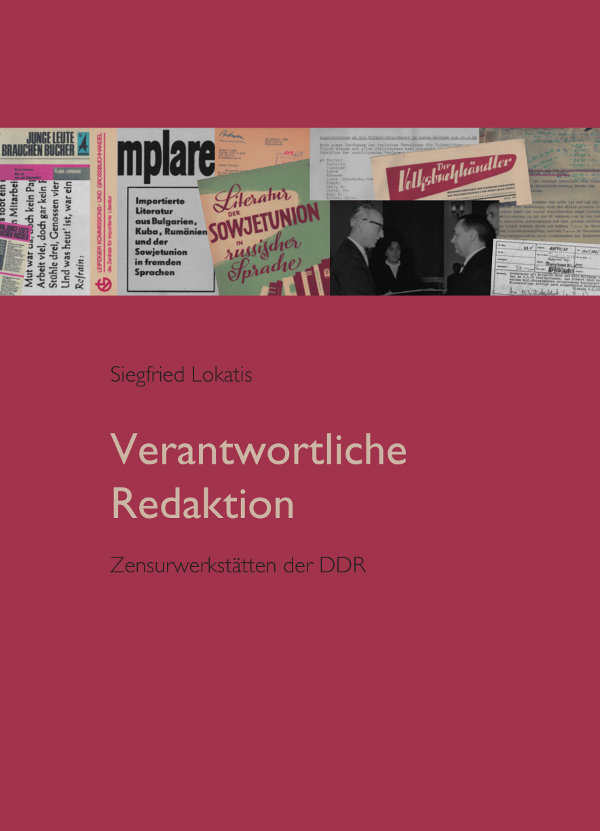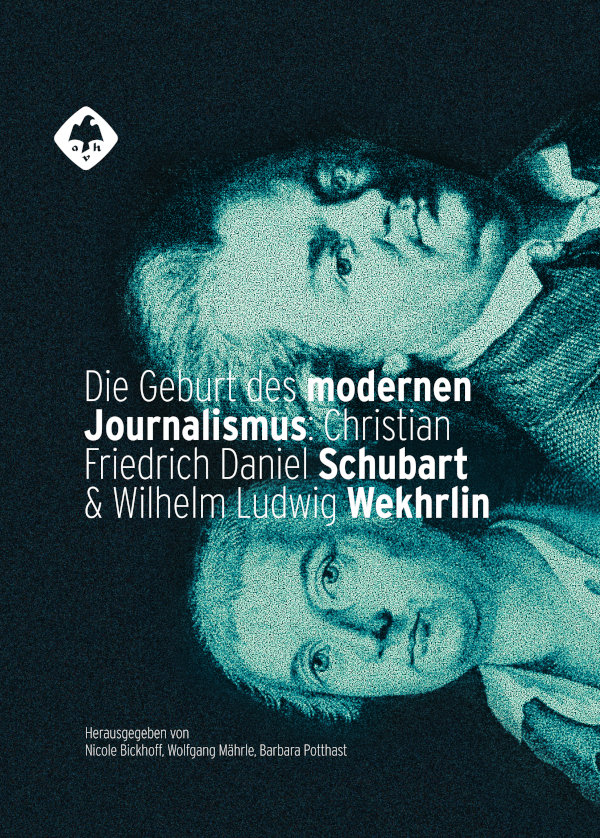Liber Aurelii ‘On Acute Diseases’ critical edition by Philipp Roelli
Reihe: Beihefte zum Mittellateinischen Jahrbuch
Band-Nr.: 21
ISBN: 978-3-7772-2203-5
Thomas Haye (Hrsg.) Vita sancti Wilhelmi Der Wilhelmitenorden und die hagiographische Heldenepik
Reihe: Beihefte zum Mittellateinischen Jahrbuch
Band-Nr.: 20
ISBN: 978-3-7772-2108-3
Thomas Haye (Hrsg.) Der Laberintus des Edmund Bramfield Eine Satire auf die römische Kurie
Reihe: Beihefte zum Mittellateinischen Jahrbuch
Band-Nr.: 19
ISBN: 978-3-7772-1712-3
Irene Erfen, Peter Schmitt (Hrsg.) De vita solitaria. Das Leben in der Einsamkeit Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 14
ISBN: 978-3-7772-2213-4
Inspiration und Prophetie in der Vormoderne Reihe: Standorte in Antike und Christentum (STAC)
Band-Nr.: 12
ISBN: 978-3-7772-2217-2
Die „Kunst des Schreibens“ Traktate zur Briefrhetorik aus dem 12. Jahrhundert
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 11
ISBN: 978-3-7772-2302-5
Prophetie Innovation, Tradition und Subversion in spätantiken Religionen
Reihe: Standorte in Antike und Christentum (STAC)
Band-Nr.: 10
ISBN: 978-3-7772-1822-9
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 10
ISBN: 978-3-7772-2131-1
Gerhard E. Sollbach (Hrsg.) Historia Albigensis Lateinisch/Deutsch
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 9
ISBN: 978-3-7772-2116-8
Bernhard Huss (Hrsg.) De remediis utriusque fortune | Heilmittel gegen Glück und Unglück Band 1: Heilmittel gegen Glück
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 8
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978-3-7772-2102-1
Bernhard Huss (Hrsg.) De remediis utriusque fortune | Heilmittel gegen Glück und Unglück Band 2: Heilmittel gegen Unglück
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 8
Heft-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7772-2200-4
Bernhard Huss (Hrsg.) De remediis utriusque fortune | Heilmittel gegen Glück und Unglück Band 1: Heilmittel gegen Glück | Band 2: Heilmittel gegen Unglück
Reihe: Mittellateinische Bibliothek
Band-Nr.: 8
Heft-Nr.: 1+2
ISBN: 978-3-7772-2224-0
Magie im antiken Christentum Eine Studie zur Alten Kirche und ihrem Umfeld
Reihe: Standorte in Antike und Christentum (STAC)
Band-Nr.: 7
ISBN: 978-3-7772-1602-7
Bodo Plachta (Hrsg.) Nathan der Weise Kritisch herausgegeben von Bodo Plachta
Reihe: Stuttgarter Studienausgaben
Band-Nr.: 5
ISBN: 978-3-7772-2221-9
Agenturen der Politik Deutsche Verlage im 20. Jahrhundert
Reihe: Leipziger Arbeiten zur Verlagsgeschichte
Band-Nr.: 5
ISBN: 978-3-7762-2203-6
Volker Meid (Hrsg.) Acht Bücher Deutscher Poematum Nach der Ausgabe von 1625 herausgegeben und kommentiert von Volker Meid
Reihe: Stuttgarter Studienausgaben
Band-Nr.: 4
ISBN: 978-3-7772-2107-6
Bücher zwischen zwei Kriegen Verlagsgründungen im frühen 20. Jahrhundert
Reihe: Leipziger Arbeiten zur Verlagsgeschichte
Band-Nr.: 4
ISBN: 978-3-7762-2106-0
From Kyivan Rus to Ukraine: Past is Present Reihe: Zeitenspiegel Essay
Band-Nr.: 4
ISBN: 978-3-7772-2301-8
Bodo Plachta (Hrsg.) Egmont Reihe: Stuttgarter Studienausgaben
Band-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-1925-7
Reihe: Leipziger Arbeiten zur Verlagsgeschichte
Band-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7762-2104-6
KarlsThron Monument und Mythos
Reihe: Zeitenspiegel Essay
Band-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-2133-5
Band-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-2013-0
Verantwortliche Redaktion Zensurwerkstätten der DDR
Reihe: Leipziger Arbeiten zur Verlagsgeschichte
Band-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7762-1319-5
Band-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7772-2419-0